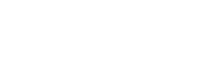Seit Februar 2020 haben sich die Lebensmittelpreise weltweit mehr als verdoppelt und seit dem Beginn des Konflikts in der Ukraine sind sie noch weiter in die Höhe geschnellt. Dadurch sind lebensnotwendige Güter für die 1,8 Milliarden Menschen weltweit, die unterhalb der Armutsgrenze leben und mit weniger als 3,20 Dollar täglichem Einkommen auskommen müssen, unerschwinglich geworden. Der Konflikt in der Ukraine ist jedoch nicht der einzige Faktor, der zur aktuellen Nahrungsmittelkrise beiträgt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass über einen längeren Zeitraum hinweg Anstrengungen unternommen werden, um die Ernährungssicherheit auf der ganzen Welt zu verbessern.
Mitte April gab die Schweizer Regierung eine Erklärung für den Fall einer Krise im Land ab, die weltweit für Schlagzeilen sorgte. Nach einer Untersuchung kam das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung zu dem Schluss, dass Kaffee "kein lebensnotwendiges Gut mehr" sei. Grund dafür ist der relativ geringe Kaloriengehalt, der nicht zur täglichen Energiezufuhr eines Menschen beiträgt. Wird der Vorschlag schliesslich gutgeheissen, kann der derzeitige Vorrat unseres Landes von 16'500 Tonnen Roh- oder Röstkaffee zum Verkauf angeboten und besser genutzt werden.
Die Schweiz und ihre Notvorräte
Die Schweiz hat keinen Zugang zum Meer und ist daher auf Importe angewiesen. Aus diesem Grund hat die Regierung seit dem Mittelalter Vorkehrungen getroffen, um auch im Falle einer schweren Lebensmittelknappheit weiterhin lebenswichtige Güter importieren zu können. Vor Beginn des Ersten Weltkriegs enthielt die Bundesverfassung jedoch keine Klauseln, die sich mit der Abwehr von Versorgungsrisiken befassten.
Während des Ersten Weltkriegs geriet die Schweiz aufgrund mangelnder Vorbereitung in Turbulenzen. Die Behörden sahen sich daher gezwungen, ein Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen einzurichten, das für alle beschaffungsrelevanten Aufgaben zuständig sein sollte.
Im Zweiten Weltkrieg hatte die Schweiz mehr Zeit sich vorzubereiten als andere Länder. Sie nutzte alle ihr zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Instrumente, insbesondere den 1940 ins Leben gerufene, so genannte "Plan Wahlen", der darauf abzielte, die Produktivität der Landwirtschaft durch die Nutzung brachliegender Flächen zu steigern. 1955 wurde ein neues Bundesgesetz verabschiedet, das sich auf die dem Privatsektor auferlegten Pflichtreserven konzentrierte.
Widerstandsfähigkeit des Schweizer Gewerbe auch während der Pandemie
Im Jahr 2020 sorgte die COVID-19-Pandemie für zahlreiche Veränderungen der Warenströme in der Land- und Ernährungswirtschaft in der Schweiz und in anderen Ländern. Trotz logistischer Hürden und Exportbeschränkungen einzelner Länder erwiesen sich die internationalen Märkte als widerstandsfähig; als direkte Folge der gestiegenen Kosten von Schweizer Verpflegung wurde jedoch der Zugang zu Grundnahrungsmitteln für Menschen in Armut erschwert. In der Schweiz ist der Zugang zur Grundversorgung mit Lebensmitteln nicht gestört worden.
Das Gastgewerbe musste als direkte Folge der Pandemieeinschränkungen Einbussen von 20 bis 30 Prozent hinnehmen, während der Detailhandel Rekordumsätze verzeichnete. Seit Februar 2020 beobachtet das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen die Situation laufend, um eine drohende Verknappung von Grundnahrungsmitteln oder Produktionsmitteln frühzeitig erkennen zu können. Dadurch konnte die Situation viel schneller unter Kontrolle gebracht werden. Ernährungsbezogene Vorkehrungen mussten jedoch nicht getroffen werden.